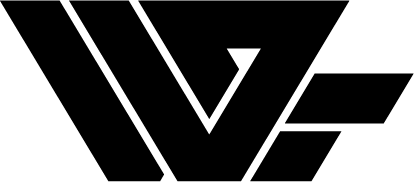Best Practice für gute Fahrradinfrastruktur aus Europa
Europa setzt auf nachhaltige Mobilität: In Utrecht steht das größte Fahrradparkhaus der Welt, während Wien mit autofreien Zonen den Einzelhandel stärkt. Kopenhagen zeigt, wie umweltfreundliche Infrastruktur den Umsatz der Geschäfte steigern kann, und Ljubljana beeindruckt mit einer autofreien Innenstadt und sauberer Luft. Helsinki eröffnet einen modernen Fahrradtunnel, der die Stadt noch fahrradfreundlicher macht. Diese Beispiele beweisen, wie durchdachte Fahrradinfrastruktur das Stadtleben, die Umwelt und die Wirtschaft nachhaltig positiv beeinflussen kann.
Städte setzen auf das Fahrrad: Innovative Infrastrukturprojekte wie das größte Fahrradparkhaus in Utrecht und autofreie Zonen in Wien, Kopenhagen, Ljubljana und Helsinki machen das Radfahren attraktiver – und stärken gleichzeitig die lokale Wirtschaft und Lebensqualität.
Utrecht – das größte Fahrradparkhaus der Welt
In Utrecht sind täglich etwa 125.000 Fahrradfahrer*innen unterwegs – das entspricht grob einem Drittel der Bevölkerung. Laut Stadtverwaltung werden hier 43 Prozent aller Fahrten unter 7,5 Kilometern mit dem Fahrrad zurückgelegt und circa 60 Prozent aller Fahrten ins Stadtzentrum erfolgen ebenfalls auf zwei Rädern. Im Vergleich dazu nutzen in Deutschland gerade einmal 23 Prozent der Pendler*innen das Rad für Kurzstrecken. Während die Fahrradwege in Utrecht gut ausgebaut sind und die Stadt als fahrradfreundlich gilt, gestaltet sich die Parkplatzsituation zunehmend schwieriger. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde ein beeindruckendes Fahrradparkhaus am Utrechter Bahnhof errichtet, das Platz für 12.500 Fahrräder bietet und auf drei Etagen verteilt ist. Die Fahrrad-Tiefgarage ist mit über 17.000 Quadratmetern die größte der Welt. Dieses Parkhaus ist nicht nur sicher, sondern auch strategisch günstig gelegen und trägt maßgeblich dazu bei, die Nutzung von Fahrrädern zu fördern, indem es Pendler*innen und Reisenden eine bequeme und geschützte Möglichkeit bietet, ihre Räder abzustellen.
Wien – Neuaufteilung des Straßenraums – mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrende
Die Neugestaltung der Mariahilfer Straße in Wien zwischen 2014 und 2015 verdeutlicht, wie Fahrrad- und Fußgänger*inneninfrastruktur einen deutlichen Standortvorteil bieten kann. Durch die Schaffung autofreier Zonen und verbesserter Fahrradspuren stieg die Besucher*innenfrequenz um 10 bis 20 Prozent, was besonders den Einzelhandel stärkte: Viele Geschäfte meldeten Umsatzsteigerungen von bis zu 10 Prozent und längere Aufenthaltszeiten der Kundschaft. Gleichzeitig sank die Anzahl der Geschäftsaufgaben, während neue Geschäfte vermehrt öffneten. Die Veränderung führte zu einem attraktiveren und sicheren Umfeld für Besucher*innen, während die Reduktion des Autoverkehrs die Luftqualität verbesserte und Lärm reduzierte. Infolge dieser Maßnahmen stieg zudem der Immobilienwert im Viertel. Durch die Mariahilfer Straße wird deutlich, wie ein verkehrsberuhigter, fahrradfreundlicher Standort die wirtschaftliche und soziale Entwicklung nachhaltig positiv beeinflussen kann.
Kopenhagen – Wie nachhaltige Infrastruktur Kopenhagens Einzelhandel stärkt
Die Neugestaltung der Nørrebrogade in Kopenhagen veranschaulicht, wie nachhaltige Infrastruktur positiv auf das Stadtleben und die Wirtschaft wirken kann. Die ehemals stark befahrene Hauptstraße wurde zu einer fahrrad- und fußgänger*innenfreundlichen Zone umgestaltet, wodurch der Autoverkehr um etwa 40 Prozent reduziert wurde, während die Zahl der Radfahrenden signifikant anstieg. Dieses Verkehrsmanagement stand ganz im Zeichen von Kopenhagens Vision, umweltfreundliche Mobilität in den Vordergrund zu stellen und die Lebensqualität für die Anwohner*innen zu steigern. Die Maßnahmen führten zwar zunächst zu Bedenken seitens der Geschäftsinhaber*innen – etwa 61 Prozent äußerten Sorgen, dass reduzierte Autozugänge Kund*innen fernhalten könnten. Doch entgegen dieser Erwartungen verbesserte sich die wirtschaftliche Situation vieler Läden, da Fußgänger*innen und Radfahrende den Einzelhandel stärker frequentierten. Die Fußgänger*innen- und Radfahrfreundlichkeit der Nørrebrogade führte dazu, dass sich Menschen länger und häufiger dort aufhielten, was eine Umsatzsteigerung um etwa 10 Prozent nach sich zog. Der Wegfall von Pkw und die ruhigere Atmosphäre machten die Straße zu einem attraktiven Ziel für Einkäufe und Freizeitgestaltung, sodass sich der Straßenraum zu einem lebendigen und wirtschaftlich attraktiven Ort entwickelte. Besonders hervorzuheben ist auch das „Green Wave“-System für Radfahrende, das eine durchgängige Fahrt bei einer konstanten Geschwindigkeit von 20 km/h ermöglicht. Dieses smarte Verkehrskonzept hat nicht nur die Radverkehrssicherheit erhöht, sondern trägt auch zur höheren Attraktivität der Straße als Einkaufsziel bei. Die Nørrebrogade in Kopenhagen ist heute ein Paradebeispiel dafür, wie durchdachte Fahrradinfrastruktur kombiniert mit fußgänger*innenfreundlichen Maßnahmen nicht nur die Aufenthaltsqualität, sondern auch die wirtschaftliche Dynamik in einem Viertel stärken kann. So wurde aus einer vormals verkehrsdominierten Zone ein Vorzeigemodell für städtische Vitalität und nachhaltigen Einzelhandel.
Ljubljana – Die Vision von Ljubljana 2025
Ljubljana stellte sich 2007 mit der „Vision von Ljubljana 2025“ erstmals die Idee eines autofreien Stadtzentrums vor – ein strategisches Dokument, das konkrete Maßnahmen zur Änderung des Reiseverhaltens der Menschen vorsah. Die Umwandlung des Stadtzentrums begann mit der Fußgängerzone der Wolfova-Straße und dem Prešeren-Platz, 2011 folgte die Umgestaltung des Kongresni-Platzes nach demselben Modell. Diese Maßnahmen haben nicht nur die Lebensqualität der Einwohner*innen verbessert, sondern auch zu einer Reduzierung der CO₂-Emissionen um bis zu 70 Prozent und einem Anstieg des Radverkehrsanteils von 16 Prozent geführt. Für das Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung wurde Ljubljana mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Grüne Hauptstadt Europas 2016 und als beste Grüne Hauptstadt Europas 2021. Das Herzstück der Transformation war die Fußgängerzone im Stadtzentrum. Obwohl diese anfänglich auf Widerstand stieß, gewann sie bis 2022 breite Unterstützung – mit 97 Prozent der Einwohner*innen, die sich für die Fortführung der autofreien Zone aussprachen. Der Anteil der Autonutzung sank von 60 Prozent im Jahr 2003 auf 41 Prozent bis 2013, während die Zahl der Fußgänger*innen und Radfahrenden, auch durch ein 2011 eingeführtes Bike-Sharing-Programm, stetig anstieg. Diese Entwicklungen verbesserten die Umweltqualität der Stadt erheblich, mit einer Verringerung der Luftverschmutzung um 70 Prozent und einer Reduzierung des Lärmpegels um sechs Dezibel. Auch wirtschaftlich war die Umgestaltung des Stadtzentrums ein Erfolg: Geschäfte, Cafés und Restaurants verzeichneten mehr Besucher*innen und höhere Sichtbarkeit, was zu einer deutlichen Belebung des Einzelhandels führte. Die Wiederbelebung öffentlicher Räume lockte sowohl Anwohnende als auch Tourist*innen an, sodass das Stadtzentrum zu einem lebendigen Treffpunkt wurde. Infrastrukturverbesserungen wie der Bau von 13 neuen Brücken und der Ausbau von Radwegen brachten diesen Wandel weiter voran. Zukünftige Pläne umfassen die Verlängerung von Radwegen von den Vororten bis ins Zentrum, um den Anteil des Autoverkehrs bis 2027 auf 33 Prozent zu senken, sowie Investitionen in Elektro- und Wasserstofffahrzeuge. Diese Bestrebungen positionieren Ljubljana in einer Linie mit anderen europäischen Städten wie Kopenhagen, die ebenfalls auf nachhaltige Mobilität und die Umgestaltung urbaner Räume setzen und damit sowohl die Umwelt als auch den Einzelhandel in erheblichem Maß positiv beeinflussen.
Helsinki – Der 220 Meter lange Fahrradtunnel
In Helsinki wurde im Mai 2024 der Kaisantunneli, ein 220 Meter langer Rad- und Fußgänger*innentunnel, eröffnet, der 33 Millionen Euro gekostet hat. An verkehrsreichen Sommertagen wird erwartet, dass täglich etwa 10.000 Radfahrer*innen die Röhre nutzen, was das Potenzial des Radverkehrs in der Stadt unterstreicht. Der Tunnel ist drei Meter hoch und acht Meter breit und bietet eine vier Meter breite Fahrradspur, die durch Bordsteine von einem dreieinhalb Meter breiten Fußgänger*innenweg getrennt ist. Neben dem Tunnel entsteht ein Fahrradzentrum mit Reparatur- und Waschanlagen. Mit fast 1.000 neuen Fahrradstellplätzen wird der Kaisantunneli den Radverkehr in Helsinki erheblich erleichtern und die Attraktivität des Radfahrens im Stadtzentrum steigern.
https://pedestrianspace.org/sustainable-mobility-in-ljubljana/
https://pedestrianspace.org/sustainable-mobility-in-ljubljana/
https://vienna-solutions.com/portfolio/the-new-mariahilfer-strasse/
https://thecityateyelevel.com/stories/europes-longest-shared-space/
https://land8.com/mariahilferstrasse-unravels-the-hidden-possibilities-of-urban-design/
https://www.resite.org/talks/mascha-onderwater-how-we-gave-back-mariahilfer-strasse-to-pedestrians
https://www.nordisch.info/finnland/220-m-langer-fahrradtunnel-in-helsinki-feierlich-eroeffnet/
https://utopia.de/utrecht-fahrrad-parkhaus-niederlande_61214/