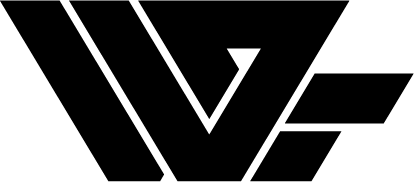Stadtgestaltung in Dortmund - Nicht nur Wissenschaft
Zoe im Interview mit Arne Markuske Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dortmund
Fachgebiet Städtebau, Bauleitplanung und Stadtgestaltungsprozesse
Arne Markuske gestaltete Städte wie Dortmund auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ist die Stadt auf dem richtigen Kurs? Welche Herausforderungen und Chancen für nachhaltige Transformation stehen ihr bevor? Ein Gespräch über widersprüchliche Bürgersteige, fehlenden politischen Willen und den Kampf gegen Privilegien.
Zoe Classen: Hallo Arne, ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, dass es Raumplanung gibt. Wenn ich durch Innenstädte laufe, frage ich mich manchmal, wer dieses neue Haus dahin gezimmert hat, weil es weder schön ist, noch irgendwie ins Gesamtbild passt. Was verstehst du denn unter Stadtplanung?
Das ist eine interessante Frage, weil es tatsächlich vielen Menschen nicht ansatzweise bewusst ist, dass die gebaute Umwelt um sie herum gestaltet ist. Wenn man mit Leuten darüber spricht, wissen die oft nicht, dass die Planung des öffentlichen Raums in unser demokratisches Gesamtsystem eingebettet ist. Jede komische Bürgersteig-Ecke, jedes verdorrte Stück Wiese auf einer Verkehrsinsel, all das ist das Produkt einer menschlichen Gestaltungsentscheidung oder eben der Verweigerung, dort etwas zu gestalten. Wir haben gewisse rechtliche Instrumente, um die gesetzten Ziele umzusetzen, weil sie zum Beispiel im Grundgesetz, im Immissionsschutzgesetz und im Bundesnaturschutzgesetz verankert sind. Das ist der Konflikt, den du gerade angesprochen hast. Man läuft durch Innenstädte und fragt sich: Wer hat das erlaubt? Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt Landesbauordnungen, und wenn dieses Gebäude den Regularien entspricht, dann kann das geplant werden. Daran sieht man, dass sich Stadtplanung in einem Spannungsfeld befindet zwischen einem übergeordneten öffentlichen Interesse – weshalb man die Möglichkeiten hat, in privates Eigentum einzugreifen – und einem ganz ganz starken Abwägungsdruck. Die Leute wollen einerseits nicht, dass „der Staat ihnen in ihr Leben reinpfuscht”. Sie regen sich aber gleichzeitig darüber auf, dass es keine allumfassende Kontrollbehörde gibt, die verhindert, dass jemand ein Gebäude baut, was ihrem persönlichen Geschmack nicht entspricht. Viel spannender ist der Teil von gemeinsamen Visionen, zum Beispiel der Masterplan Mobilität der Stadt. Das ist erstmal nicht falsch, aber solche Pläne sind meistens unkonkret. Da stehen dann Dinge drin wie zum Beispiel: “Wir wollen den täglichen Rad-Pendelverkehr erhöhen, indem Radfahren mehr Spaß macht.” Darin sehe ich unseren Auftrag: in der Stadtgestaltung. Das hat dann eine technische Ebene, wo ich in irgendwelche DIN-Normen reingucken kann oder in Empfehlungen vom ADFC. Das ist alles wichtig, aber noch keine Gestaltung. Unsere Aufgabe ist, aus diesen ganzen Anforderungen etwas zu entwickeln, was all dem entspricht, im besten Falle noch gut aussieht und vor allen Dingen auch mit der Umgebung funktioniert. Ich sage immer frei nach Jan Gehl (Anm. der Red.: niederländischer Architekt): „Das zwischen den Häusern.”
Gibt es eine Art Workflow, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Masterplan entwirft?
Nein. Es fehlt nicht an unserer Expertise, Dortmund fahrradfreundlicher zu machen. Es ist der fehlende politische Wille, bestehende Privilegien der Autofahrenden und vielleicht auch der eigenen Wählerschaft anzugreifen. Das ist eine erschreckende Parallele zum Klimawandel. Der Wissenstransfer aus unserem akademischen Elfenbeinturm in die Praxis findet statt. Und der findet auch schon seit 40 Jahren statt. Die Leute kommen bei uns raus und haben ein sehr klares Bild davon, was lebenswerte Städte sind. Seit den Achtzigern wissen wir, dass sich Verkehrsprobleme nicht durch mehr Straßen lösen lassen. Mehr Straßen erzeugen mehr Autoverkehr. Wenn ich möchte, dass der ÖPNV mehr genutzt wird, dann muss ich ihn massiv ausbauen, die Taktung erhöhen und ihn viel günstiger machen. Es gibt kein Wissensproblem. In der Stadt Dortmund fehlt der Mut, Veränderungen durchzusetzen – bei so einigen Transformationsprozessen.
Wenn wir jetzt aus wissenschaftlicher Sicht von oben auf Dortmund draufschauen – was sehen wir dann?
Wir sehen das sehr interessante Konstrukt einer extrem jungen Siedlungsform. Das ist eine Siedlungsstruktur, die ganz stark auf Individualmobilität basiert, aber eben auf dem Auto. Das hat einen neuen Maßstab eingebracht, und gleichzeitig gilt ja auch: Verkehrsinfrastruktur soll Menschen verbinden und gleichzeitig für eine räumliche Trennung sorgen. Wir haben eine hohe Konnektivität zwischen Knotenpunkten, zum Beispiel haben wir im Ruhrgebiet eine unglaublich hohe Autobahndichte. Es gibt hier in Dortmund wenige Strecken, auf denen man mit dem Auto langsamer ist als mit anderen Verkehrsmitteln. Das fand ich unglaublich frappierend, als ich aus Berlin hierher gezogen bin. Dort ist man auf einer etwas weiteren Strecke mit der U-Bahn immer schneller gewesen; auf kürzeren Strecken immer mit dem Fahrrad. Wenn wir von oben auf Dortmund schauen, dann sehen wir eine unglaubliche Menge an Verkehrsinfrastruktur und dadurch gleichzeitig einen stark fragmentierten Siedlungsraum. Weshalb eigentlich die überragende Eigenschaft dieser Siedlungsstruktur ist, dass sie sehr undurchlässig ist – für alles, was nicht das Auto ist. Dazu kommt ein hohes Maß an Zersiedelung, weil es sich eben lohnt, an schönen Orten zu leben – wo man ein Auto zur Fortbewegung dringend braucht.
Wir sehen zwei große Herausforderungen. Zum einen muss die Stadt umstrukturiert werden, zum anderen muss sich das Verhalten der Menschen verändern. So wie wir die Stadt in den letzten Tagen erlebt haben, muss alles auf links gedreht werden.
Tatsächlich ja. Wenn irgendeine von diesen Wenden, die ausgerufen wurden, ernst gemeint ist, oder wenn ich die Vielzahl der globalen Krise betrachte, dann müssten wir eigentlich die gesamte Umwelt um uns herum grundlegend verändern. Wir als westliche Welt stehen dafür auch in der Verantwortung, weil wir sie verursacht haben. Natürlich haben wir in den letzten Jahrzehnten auch einige Errungenschaften vorzuweisen. Aber: Was man nach dem Zweiten Weltkrieg für das Auto getan hat, müsste man jetzt für die Menschen tun. Da schaue ich z.B. nach Paris, wo ja wirklich großflächige Boulevards umgestaltet werden. In San Francisco wird die Flächenbilanz einfach umgedreht. Da ist dann in der Mitte der Zweirichtungs-Radweg, so breit wie zwei Autospuren, und am Rand eine Spur für Autos, die aber auch eher für Taxen und Busse gedacht ist. Das heißt nicht, dass es überall so aussehen muss, weil diese Ideen sehr innerstädtisch sind. Man gibt sich einer Illusion hin, wenn man denkt, dass das ohne Konflikte vonstattengehen kann. Raum ist ein begrenztes Gut. In den 1980ern wurde mal ein 30-Hektar-Ziel ausgesprochen. Es ging darum, pro Tag nicht mehr Fläche als 30 Hektar zu versiegeln. Dieses Ziel haben wir bis heute nicht erreicht. Zur Zeit liegen wir bei knapp 60 pro Tag. Es ist ziemlich erschreckend, dass sich da nix geändert hat. Angesichts planetarer Grenzen wird das hoffentlich mehr Menschen bewusst. Als Konsequenz muss man sich überlegen, wie dieser Raum im besten Falle fair verteilt werden kann. Wir werden die nachhaltige Transformation nicht schaffen, ohne dem Autoverkehr Platz wegzunehmen.
Uns ist aufgefallen, dass es in der vorhandenen Infrastruktur wenig einheitliche Gestaltung gibt. Manchmal sind die Radwege rot, manchmal sehen Abstellbügel eckig aus, manchmal rund und manchmal muss man sich als radfahrende Person auf einer Kreuzung vor den Autos positionieren. Kann man mit diesen zerstückelten Ansätzen eine Stadt auf links drehen?
Irgendwo muss man ja mal anfangen. Ein Problem in Deutschland ist auch, dass Kommunen finanziell betrachtet kaum handlungsfähig sind. Sie sind kaum in der Lage, aktiv zu gestalten, sondern es geht oft darum, den Mangel zu verwalten. Wenn wir Städte zukunftsfähig verwalten wollen, dann brauchen wir auch handlungsfähige Verwaltungen. Da geht es auch um einen Stock von Menschen, die nicht jeden Tag frustriert an ihren Arbeitsplatz kommen, sondern auch noch in der Lage sind, gute Ideen zu entwickeln. Das sehen wir auch in Deutschland und Europa sehr oft. München ist zum Beispiel stadtplanerisch eine sehr gut entwickelte Stadt. Das hat damit zu tun, dass die Verwaltung dort in den Neunzigern und Nullerjahren nicht komplett kahl gespart wurde. Fünf Jahre Großbaustelle und danach ist die Stadt fahrradfreundlich, würde ja auch nicht funktionieren. Es ist sehr sinnvoll, die Lebenszyklen, die gewisse Bauteile und Oberflächen haben, zu nutzen und direkt neu zu denken. Das wirkt aus so einer utopischen Sicht unbefriedigend. Aber aber worauf man trotzdem achten sollte, ist dieses Phänomen deutscher Fahrradinfrastruktur, worauf Jan Böhmermann auch schon aufmerksam gemacht hat: der Fahrradweg hört komischerweise immer irgendwo auf, die Straße aber nicht. Diese Herangehensweise verleitet dazu, Dinge als insuläre Projekte zu sehen. Ein Abschnitt wird sehr schön gemacht, aber wie man da erstmal hinkommt, wird nicht mitgedacht. Das ist so eine typische Beamtendenke, nicht nach links und rechts zu schauen und bestimmte Abteilungen bei solchen Projekten nicht mit einzubeziehen. Es gibt einen Unterschied darin, etwas zu bauen, was sich nur an alle Vorgaben hält oder was sich wirklich gut nutzen lässt.
Was gibt es für Möglichkeiten für die Bürger*innen, sich an der Stadtgestaltung zu beteiligen?
Es gibt sehr viele niederschwellige Möglichkeiten. Die Einfachste ist natürlich, sich zu fragen, wen man wählt. Es bringt auch viel, in Gesprächen mal die Frage zu stellen, wie es eigentlich sein kann, dass Leute das Recht haben, zwölfeinhalb Quadratmeter – so groß ist ein Auto – im öffentlichen Raum, der uns allen gehört, zu besetzen. Wenn ich meinen Klappstuhl und meinen Grill von Zuhause hole und mich in eine Parklücke setze, dann kommt das Ordnungsamt, oder im schlimmsten Fall haut mir jemand in die Fresse. Da sollte man sich schon die Frage stellen, ob da nicht ein enormes Ungleichgewicht herrscht. Die Realität, die wir sehen und akzeptieren, muss nicht Normalität bleiben. Ein guter Schritt ist auch, schon im Privaten für solche Themen zu mobilisieren.
Der Leipziger Oberbürgermeister hat vor einer Weile gesagt, dass es nicht normal sei, dass sich vor dem Hauptbahnhof an der Ampel hunderte Menschen tummeln würden, den Weg mit Radfahrenden, Leuten im Rollstuhl, Kinderwagen und so weiter teilen, und davor eine vierspurige Stadtautobahn stattfindet, wo mit 50 bis 70 km/h gefahren wird. Es gab riesigen Aufschrei, als er meinte, dass die Stadt nicht für Autos, sondern für Menschen gemacht ist.
Das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis, wenn man in der Planungspraxis unterwegs ist, dass Menschen generell keine Veränderungen mögen. Ich persönlich auch nicht. Das ist auch einfach sehr menschlich. Deshalb braucht man gerade als Politiker*in ein sehr dickes Fell. Man muss wissen, was man will und das durchziehen und einen langen Atem haben, denn gerade in der Stadtgestaltung sieht man die Resultate oft erst ein paar Jahre später.
Wird eine Straße autofrei gemacht, gehen erstmal die Umsätze der Geschäfte runter. Es kann total gut sein, dass das erstmal so ist, aber wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass sie nach einem Tief immer massiv hochgehen. Also, Dinge brauchen ihre Zeit, um zu wachsen, und um diese Phase zu überwinden, wo dann alle schon darauf warten, dass es als gescheitert deklariert wird. Das braucht wirklich sehr sehr viel politischen Mut.
Es gibt die geplanten Velorouten, die teilweise schon gebaut werden, die sternförmig in die Innenstadt führen sollen. Sie weichen aber oft von den Hauptpendelrouten ab. Warum macht man das?
Politische Bequemlichkeit. Punkt. Wir sind in Deutschland sehr bemüht, dass das Auto immer den direktesten Weg nehmen kann, das ist sogar gesetzlich verankert. Der fließende Autoverkehr hat in Deutschland eine perverse Priorität. Das zieht sich durch das Mindset von Leuten, durch Planungsbüros und eben auch durch unsere Gesetze. Es gibt aber zwei Mobilitätsarten, die unglaublich sensibel sind, was Umwege betrifft, die auch ganz schnell substituiert werden, wenn sie keinen Spaß machen: das Fahrrad und das zu Fuß gehen. Das beobachten wir an allen Stellen. Bei uns im Hof wird zum Beispiel ein neues Rad-Häuschen gebaut, und ich bin mal gespannt, wie das angenommen wird. Denn eine Erfahrung, die wir hier immer wieder machen, ist, dass man es den Menschen so einfach wie möglich machen muss. Also wenn man sich nicht traut, direkte Verkehrsverbindungen zu verändern, dem Auto also etwas wegzunehmen, und vermutlich Ärger dafür zu bekommen, und man deshalb Fahrradrouten anderswo lang führt, dann ist das politische Bequemlichkeit. Um diese Entscheidungen in Schutz zu nehmen: Es kann natürlich Vorteile haben, diese Routen voneinander abweichen zu lassen, wenn dadurch Sicherheit gewährleistet ist, oder Feinstaubbelastung verringert werden kann. Aber grundsätzlich sollte man Radfahrenden und vor allem Fußgänger*innen immer den kürzesten Weg ermöglichen.
Vielen Dank.